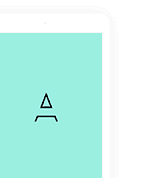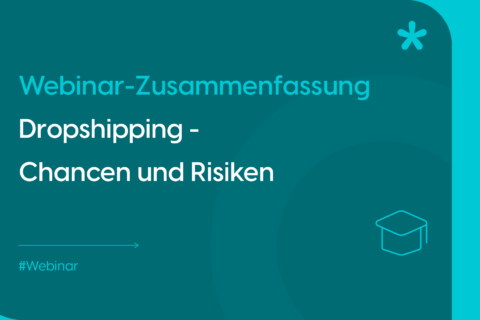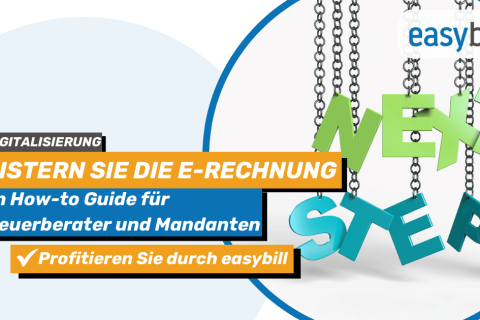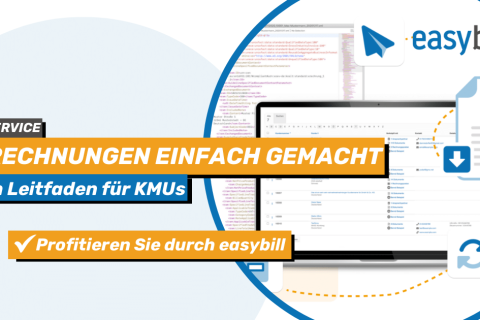Das Umsatzsteuergesetz (UStG) betrifft jedes Unternehmen. Es regelt nicht nur, wann Umsatzsteuer erhoben werden muss, sondern auch, welche Angaben auf Rechnungen verpflichtend sind, wie lange Belege aufzubewahren sind und wie die Steuer ans Finanzamt gemeldet wird.
Schon kleine Fehler, etwa eine fehlende Pflichtangabe auf einer Rechnung oder das Versäumen einer Abgabefrist, können zu Bußgeldern oder dem Verlust des Vorsteuerabzugs führen. Wer die wichtigsten Regelungen kennt und auf Änderungen achtet, spart nicht nur Zeit und Geld, sondern reduziert auch das Risiko teurer Nachzahlungen.
Das Umsatzsteuergesetz im Überblick
Das Umsatzsteuergesetz (UStG) ist in 18 Abschnitte gegliedert und umfasst unter anderem:
- § 1–3: Steuerbare Umsätze, Leistungsort und Lieferungen
- § 4: Steuerbefreiungen (z. B. Ausfuhrlieferungen, medizinische Leistungen)
- § 10–13: Bemessungsgrundlage, Entstehung der Steuer und Steuersätze
- § 14–14c: Rechnungsstellung und Aufbewahrungspflichten
- § 15: Vorsteuerabzug
- § 18–20: Steuererklärungen und Voranmeldungen
- § 19: Kleinunternehmerregelung
- § 25 ff.: Sonderregelungen für Reiseleistungen, Differenzbesteuerung, innergemeinschaftliche Erwerbe
Für Unternehmer ist es besonders wichtig, die Regelungen zu Rechnungen, Vorsteuerabzug, Kleinunternehmerregelung und den Meldefristen zu kennen.
Was ist das Jahressteuergesetz? Neuerungen im Umsatzsteuergesetz
Das Umsatzsteuergesetz in Deutschland unterliegt regelmäßigen Anpassungen, derer sich Unternehmer bewusst sein sollten. Ziel dieser Gesetzesreform ist es, steuerrechtliche Regelungen zu aktualisieren und an neue wirtschaftliche Entwicklungen anzupassen. Auch im Jahr 2025 gibt es mehrere Änderungen, die insbesondere die Umsatzsteuer betreffen und für Unternehmer relevant sind.
1. Einführung der E-Rechnungspflicht (§ 14 UStG)
Am 1. Januar 2025 beginnt die schrittweise Einführung der E‑Rechnungspflicht für alle B2B-Geschäfte in Deutschland. Im Zuge dessen sind Unternehmen und Selbstständige ab 2025 dazu verpflichtet, E-Rechnungen empfangen zu können.
Für die Erstellung und den Versand von E-Rechnungen gelten längere Übergangsfristen: Ab 2027 gilt die Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen für Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 800.000 €, bis schließlich ab 1. Januar 2028 alle Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen ausstellen müssen.
Tipp: Jetzt auf die E-Rechnung umstellen und die Buchhaltung digitalisieren. Mit easybill ist das gar kein Problem und schnell gemacht. easybill wird als Rechnungsprogramm von vielen Steuerberatern empfohlen.
2. Verkürzte Aufbewahrungsfristen (§ 14b UStG)
Die Aufbewahrungsfrist für Rechnungen wird von 10 auf 8 Jahre reduziert.
Wörtlich heißt es in § 14b Abs. 1 UStG: „Rechnungen sind zehn Jahre aufzubewahren.“ – ab 2025 gilt hier die geänderte Frist von 8 Jahren.
Wichtig: Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.
3. Neuerungen bei der Kleinunternehmerregelung
Die Kleinunternehmerregelung, die es Unternehmen ermöglicht, von der Umsatzsteuer befreit zu bleiben, erfährt durch das Jahressteuergesetz ebenfalls Anpassungen. Ab dem neuen Steuerjahr werden die Umsatzgrenzen für Kleinunternehmer angehoben. Das bedeutet:
Die Umsatzgrenze, bis zu der Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer erheben müssen, wird für das aktuelle Jahr von 50.000 auf 100.000 EUR erhöht. Im Vorjahr darf der Umsatz anstelle von bisher 22.000 EUR nun bei maximal 25.000 EUR liegen.
Neu ist hierbei allerdings, dass es sich bisher bei dem Wert für das aktuelle Jahr um eine Umsatzprognose handelte, die man zu Jahresbeginn erstellen muss. Aus dieser Prognose wird mit den 100.000 EUR nun ein fester Wert. Wird dieser überschritten, hat umgehend, auch unterjährig, ein Wechsel in die Regelbesteuerung zu erfolgen.
Wer bisher knapp unter der alten Grenze lag, hat nun mehr Spielraum, ohne sofort in die Umsatzsteuerpflicht zu rutschen. Für bestehende Kleinunternehmer bietet dies eine Gelegenheit zum Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit, ohne direkt eine zusätzliche Steuerlast zu tragen.
Ebenfalls neu für Kleinunternehmer ist der Wegfall des bisher notwendigen “Nullmeldung” als Umsatzsteuer-Jahreserklärung. Diese ist ab jetzt nur noch erforderlich, wenn es steuerlich relevante Umsätze gab, was beispielsweise bei Auslandsgeschäften der Fall sein könnte.
4. Änderungen bei der Umsatzsteuervoranmeldung
Eine der zentralen Neuerungen im Jahressteuergesetz 2024 betrifft die Meldefristen und die Verfahren zur Umsatzsteuervoranmeldung. Ab 2025 werden die Anforderungen an die elektronischen Meldungen verschärft, und es wird vermehrt auf digitale Prozesse gesetzt. Für Unternehmer bedeutet dies:
Bei einer Umsatzsteuerschuld im Vorjahr von weniger als 2.000 EUR (bisher 1.000 EUR) ist eine Befreiung von der Umsatzsteuervoranmeldung möglich, in diesem Fall muss ein Unternehmen nur noch eine Jahresmeldung einreichen.
Liegt die Vorjahresschuld über 2.000 EUR, aber noch unter 9.000 EUR (bisher über 1.000 EUR aber unter 7.500 EUR), ist die Voranmeldung vierteljährlich einzureichen.
Erst wenn die Umsatzsteuerschuld im Vorjahr über 9.000 EUR (bisher 7.500 EUR) lag, muss die Voranmeldung monatlich erfolgen.
5. Mehr Zeit für die Steuererklärung durch Steuerberater
Wenn die Steuererklärung 2024 von einem Steuerberater eingereicht wird, profitieren Unternehmen von einer verlängerten Frist. Du musst diese dann erst bis zum 30. April 2026 abgegeben haben. Machst du die Erklärung selbst, hast du hierfür nur bis zum 31. Juli 2025 Zeit.
6. Einkommenssteuer: Grundfreibetrag wird angehoben
Rückwirkend zum 01. Januar 2024 wurde der Grundfreibetrag für die Einkommenssteuer angehoben – und zwar auf 11.784 EUR. Hierbei handelt es sich um den Wert, bis zu dem Einkommen nicht besteuert wird.
Eine erneute Erhöhung gilt für das Jahr 2025. Der Grundfreibetrag liegt nun bei 12.096 EUR.
7. Erhöhung der Grenze für Minijobs auf 556 Euro
Durften Minijobber bisher maximal 538 EUR pro Monat verdienen, steigt dieser Wert im Jahr 2025 auf 556 EUR.
Der Grund hierfür die direkte Koppelung von Minijobs an den Mindestlohn, der ebenfalls angehoben wurde: Von 12,41 EUR pro Stunde auf 12,82 EUR.
8. Vorsteuerpauschale für Land- und Forstwirte sinkt
Wenden Landwirte die sog. Durchschnittssatzbesteuerung an, profitieren Sie von einem geringeren Satz. Bis zum 6. Dezember 2024 lag dieser bei 9%, ab diesem Datum wurde er auf 8,4% gesenkt und seit dem 1. Januar 2025 beträgt er nur noch 7,8%.
Bist du auf die Änderungen vorbereitet?
Das Jahressteuergesetz 2024 bringt viele wichtige Änderungen für Unternehmer, insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer. Von neuen Meldefristen über angepasste Umsatzgrenzen bis hin zu Änderungen bei der Besteuerung internationaler Dienstleistungen und Warenlieferungen – es gibt viele Aspekte, die Sie im Blick behalten sollten.
Um optimal vorbereitet zu sein, empfehlen wir:
- Überprüfe deine Buchhaltungsprozesse und stellen Sie sicher, dass Sie die neuen Fristen und Meldepflichten einhalten.
- Analysiere deine Umsätze, um zu ermitteln, ob die neue Kleinunternehmerregelung relevant sein könnte.
- Halte Rücksprache mit deinem Steuerberater, von welchen Regelungen du bzw. dein Unternehmen betroffen ist.
Mit der richtigen Vorbereitung und Unterstützung können Sie die neuen Herausforderungen des Jahressteuergesetzes 2025 erfolgreich meistern.
Tipp: easybill unterstützt dich als Rechnungsprogramm dabei, jederzeit rechtskonforme Rechnungen zu erstellen und auf die E-Rechnung umzustellen.
Häufige Fehler beim Thema Umsatzsteuer
Auch erfahrene Unternehmer können in der Praxis Fehler machen, die sich leicht vermeiden lassen:
- Rechnungen ohne alle Pflichtangaben ausstellen – das kann den Vorsteuerabzug kosten.
- Fristen für Voranmeldungen oder Jahresmeldungen verpassen – das führt schnell zu Verspätungszuschlägen.
- Umsatzgrenzen für Kleinunternehmer nicht im Blick behalten – wird die Grenze überschritten, droht eine ungeplante Steuerpflicht.
- Reverse-Charge-Verfahren falsch anwenden – fehlerhafte Meldungen bei grenzüberschreitenden Leistungen können teure Korrekturen nach sich ziehen.
Wer diese Punkte regelmäßig prüft, kann viele Probleme vermeiden und das Umsatzsteuergesetz sicher im Geschäftsalltag anwenden.
Häufig gestellte Fragen zum Umsatzsteuergesetz (UStG)
Was ist der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Besteuerung?
- Soll-Besteuerung (§ 16 UStG): Die Umsatzsteuer entsteht, sobald die Leistung erbracht oder die Rechnung gestellt wurde – unabhängig davon, ob der Kunde schon bezahlt hat.
- Ist-Besteuerung (§ 20 UStG): Die Umsatzsteuer wird erst fällig, wenn die Zahlung tatsächlich eingeht. Diese Methode ist für viele kleine Unternehmen und Freiberufler vorteilhaft, weil sie die Liquidität schont.
Tipp: Die Ist-Besteuerung muss beim Finanzamt beantragt werden und ist nur unter bestimmten Umsatzgrenzen oder bei Freiberuflern zulässig.
Welche Leistungen sind nach § 4 UStG von der Umsatzsteuer befreit?
Das UStG listet zahlreiche steuerfreie Umsätze auf, darunter:
- Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen (Warenexporte ins Ausland oder in andere EU-Staaten)
- Medizinische Heilbehandlungen durch Ärzte oder Heilpraktiker
- Bildungsleistungen wie bestimmte Schul- und Hochschulkurse
- Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Achtung: In vielen Fällen kann der Unternehmer freiwillig auf die Befreiung verzichten, um den Vorsteuerabzug zu nutzen (Option zur Steuerpflicht).
Was ist das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG)?
Beim Reverse-Charge-Verfahren verlagert sich die Steuerschuld vom leistenden Unternehmer auf den Leistungsempfänger. Typische Fälle sind:
- Bauleistungen zwischen Bauunternehmen
- Leistungen aus dem Ausland an deutsche Unternehmer
- Handel mit bestimmten Metallen oder Elektronik
Der Leistungsempfänger muss die Umsatzsteuer in seiner Voranmeldung erklären und kann sie gleichzeitig als Vorsteuer abziehen, wenn er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Wie funktioniert die Differenzbesteuerung (§ 25a UStG)?
Die Differenzbesteuerung gilt für Händler, die gebrauchte Waren, Kunstgegenstände oder Sammlerstücke weiterverkaufen.
Die Umsatzsteuer wird nur auf die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis berechnet – nicht auf den gesamten Verkaufspreis. Das senkt die Steuerlast und ist insbesondere im Gebrauchtwarenhandel relevant.
Was passiert, wenn ich gegen das UStG verstoße?
Verstöße gegen das Umsatzsteuergesetz können teuer werden:
- Verspätungszuschläge bei verspäteter Abgabe von Voranmeldungen
- Bußgelder bei falscher oder fehlender Rechnungsstellung
- Steuerstrafverfahren bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung
Unternehmer sollten ihre Fristen und Rechnungsangaben daher konsequent einhalten und alle Belege sorgfältig archivieren.
Muss ich als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuer-ID beantragen?
Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist für rein inländische Geschäfte nicht zwingend nötig.
Wer jedoch Leistungen ins EU-Ausland erbringt oder von dort bezieht, benötigt eine Umsatzsteuer-ID, um am innergemeinschaftlichen Handel teilnehmen zu können.
Welche Besonderheiten gelten für den Onlinehandel und digitale Dienstleistungen?
- OSS-Verfahren (One-Stop-Shop): Onlinehändler, die Waren oder digitale Leistungen an Privatkunden in anderen EU-Ländern verkaufen, können ihre gesamte EU-Umsatzsteuer über ein zentrales Portal melden.
- Digitale Dienstleistungen: Ort der Leistung ist in der Regel der Wohnsitz des Verbrauchers. Damit können sich Umsatzsteuerpflichten in mehreren EU-Ländern ergeben.
Lesen Sie außerdem:
E-Rechnungs-Pflicht 2025
Was ist eine E‑Rechnung?
Die E-Rechnung und Kleinunternehmer: So gelingt der Umstieg 2025!